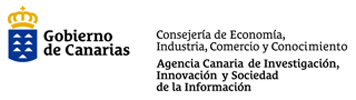In Deutschland findet man Kultur nicht nur in Museen oder historischen Gebäuden. Sie lebt auch im Alltag weiter – in überlieferten Rezepten, in festlichen Bräuchen, in der Musik, die die Theater füllt, und in der Art und Weise, wie sich Menschen zusammenschließen, um gemeinsam mehr zu erreichen. Die Deutsche UNESCO-Kommission würdigt diese kulturelle Vielfalt durch ihre „Liste des immateriellen Kulturerbes“. Aktuell umfasst sie 27 Traditionen und Wissensformen, die einen bedeutenden Teil der deutschen Identität darstellen. Hier stellen wir einige der eindrucksvollsten Beispiele vor:
Deutschland gilt weltweit als das Land des Brotes. Mit über 3.000 registrierten Sorten bietet kein anderes Land eine vergleichbare Vielfalt. Ob Dinkel, Roggen, Weizen oder Vollkorn – jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten, viele mit jahrhundertealter Geschichte. Das Bäckerhandwerk bewahrt nicht nur traditionelle Techniken und Rezepte, sondern integriert auch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse. Schon im Mittelalter verbreiteten wandernde Bäcker mit dem bekannten „Bäckertanz“ ihr Wissen und nahmen gleichzeitig fremde Einflüsse in ihre Rezepte auf.
Im Osten Deutschlands lebt eine besondere Gemeinschaft: die Sorben der Lausitz – eine slawische Minderheit mit eigener Sprache, Tracht und lebendigen Festen. Etwa 30 überlieferte Bräuche werden von Generation zu Generation weitergegeben. Besonders beliebt ist die sogenannte „Vogelhochzeit“. Am Vorabend des 25. Januar stellen Kinder Teller vor die Haustür, in der Hoffnung, am nächsten Morgen süße Gebäcke in Vogelform vorzufinden – ein Symbol für Liebe und Neubeginn.
Mit rund 360 Theatern, 130 Opernhäusern, zahlreichen Sinfonie- und Kammerorchestern sowie etwa 70 jährlichen Festivals gehört Deutschland zu den kulturell reichsten Ländern Europas. Millionen von Besuchern erfreuen sich jedes Jahr an Opern, Musicals, Konzerten, Tanz- und Puppentheater. Diese Vielfalt hat Tradition: Bereits im 17. und 18. Jahrhundert, als das Heilige Römische Reich aus vielen kleinen Staaten bestand, entstanden erste kulturelle Zentren mit starkem künstlerischem Profil.
„Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ – Dieser Gedanke von Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) bildet das Fundament der Genossenschaftsidee. In Genossenschaften schließen sich Menschen zusammen, um auf Grundlage ethischer Werte wie Gerechtigkeit, Solidarität und bürgerschaftliches Engagement gemeinsame Ziele zu verfolgen. Bis heute ist diese Idee lebendig geblieben: In Deutschland gibt es über 21 Millionen Genossenschaftsmitglieder in Bereichen wie Arbeit, Wohnen, Ernährung oder Finanzen. Genossenschaften sind ein lebendiges Beispiel dafür, wie Werte in tragfähige Lösungen für den Alltag übersetzt werden können.
In Deutschland werden Traditionen nicht als Relikte der Vergangenheit betrachtet, sondern als lebendige Ausdrucksformen einer sich ständig weiterentwickelnden kulturellen Identität. Diese kulturelle Vielfalt ist ein Grund zur Freude – und ein Vorbild für gelebtes Erbe im Alltag.